EINFÜHRUNG
Meine Beschäftigung mit traditionellen und alternativen Ausbildungs-, Trainings- und Therapiemethoden reicht zurück bis in die frühen 80ger. In meiner über mehrere Jahre ('81 bis'89) am Staatstheater am Gärtnerplatz in München durchgeführten Workshopreihe "SINGING ACTOR - ACTING SINGER" wurde eine alternative Ausbildungsmethode entwickelt, das „Integral Performing“ (ganzheitliche Darstellung), die vor allem auf der minutiös erarbeiteten Überzeugung beruht, dass die Gleichung „Musiktheater = Schauspiel plus Gesang und Musik“ auf gravierenden Missverständnissen beruht und der Ansatz , dass ein „Stehsänger“ durch Schauspielunterricht zum Musiktheaterdarsteller wird, nicht haltbar ist.
Zu eine Schlüsselerlebnis wurde ein mit „Schauspielschülern“ verschiedener Münchner Schulen durchgeführtes Experiment unter dem Arbeitstitel „Der nackte Darsteller“ , das zu einem Resultat führte, das für das darstellerische Selbstverständnis und das Selbstwertgefühl der nach den Strasbergschen Doktrinen geschulten jungen Schauspielern eine radikale Enttäuschung war, und gleichzeitig eine neue Wertung der verschiedenen darstellerischen Komponenten brachte. Das Szenario: Die völlig leere
Bühne (damals des Staatstheaters am Gärtnerplatz) Aber ich ging weiter: Kein Stück, keine Handlung, und vor allem kein Text... Und dann die absurd scheinende Anweisung : jetzt spielt mal irgendwas! Es wurde sehr schnell klar, dass die menschliche Ausdrucksfähigkeit viel geringer ist, als allgemein angenommen wird. Es gab eigentlich nur DREI BEFINDLICHKEITEN die gedeutet werden konnten,
eine positive, die Gestik des Wohlfühlens und der Freude, und
zwei negative: „die Erbleichende“ (z.B. Kummer) und
die „Errötende“ (z.B. Wut). Außerdem wurde
klar, dass es völlig unmöglich ist, zu unterscheiden ob
der „Anlass“ im Denken oder dem Gefühl , also der
Psyche lag, die körpersprachliche Umsetzung also „psycho-somatisch“
war, oder im sensitiv körperlichen, also somato-psychisch.
(z.B. ist der Ausdruck „geistiger Skepsis“ und der Ausdruck
eines „seltsamen Geschmacks“ nicht zu unterscheiden.) Und damit war auch einerseits
klar, dass Intensität nicht das Maß für „den
Druck im Ausdruck“ ist, sondern das Maß des „Materialaufwands“.
Und dieses Arbeitsprinzip, dass es nämlich genügt, die Befindlichkeit der agierenden Figur glaubhaft zu suggerieren, schafft den Freiraum, den der Sängerdarsteller für den Gesang braucht. Denn es steht außer Frage, dass höchster sängerischer Aufwand kaum Freiraum für Darstellung lässt. Kalafs „vinceró“ oder Manricos „all’ armi“ genügen sich selbst, aber auch die anspruchvollsten Partien bestehen nicht nur aus Spitzentönen, und dann kann ein wenig Darstellung nicht schaden... Die
beiden größten Theaterlehrer des 20. Jh. Stanislawski
und Strasberg haben selbst ihr „System“ (Stanislawski)
bzw. ihre „Method“ (Strasberg) für Musiktheater-
untauglich erklärt. Aus einem einfachen Grund: Sprechtheaterdarstellung=
„Schauspiel“ fordert weitgehend „Realismus“
(ein Darstellungsprinzip, das allerdings auf ziemlich verschiedene
Arten realisiert werden kann) , die Darstellung vor der Kamera sogar
eine Art „Lebensidentität “, genau das muss Musiktheaterdarstellung
NICHT haben. Darstellung, deren wichtigste Parameter durch die musikalische
Vorlage vorgeschrieben sind (u.a. Phrasierung, Tempo, Dynamik, und
natürlich die Deutung des Textes durch den Komponisten!), kann
und muss nicht realistisch sein. |
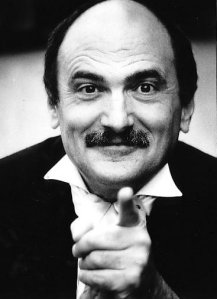
storz,
'87 |

